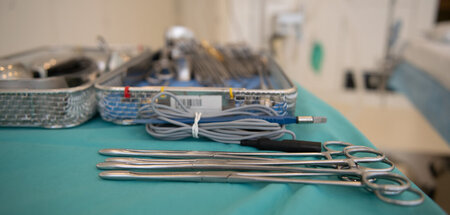Erstellt von Redaktion am 19. August 2024
Linkspartei – Das kleinere Übel und seine Verwalter
05/31/2024 Linksparteidebatte Debatte TopNews
Debattenbeitrag von Paul Nielsen
(Zuerst veröffentlicht in www.scharf-links.de)
Der kurze Aufruf zum Wahl der Linkspartei (https://wirwaehlenlinks.de/) von einigen mehr oder weniger prominenten Personen aus deren Umfeld wurde auf allerhand Mailinglisten herumgeschickt. Er richtet sich „an alle“ und ist nicht zielgruppenspezifisch. Dabei wäre es angebracht, sich mit der Enttäuschung vieler Personen auseinanderzusetzen, die lange Linkspartei gewählt haben. Viele sind angesichts deren Politik (vgl. z. B. das sektiererische Verhalten gegen die große Friedenskundgebung am 25. 2. 23 in Berlin) und Personal mittlerweile nachhaltig deprimiert.
Der Aufruf meint, es bei Phrasen und Schlagwörtern belassen zu können. Zu diesem wenig geistig inspirierten und wenig inspirierenden Fortsetzungsverhalten („Jetzt müssen wir schon wieder Wahlkampf machen, sind selbst von unserer Partei nur sehr mäßig überzeugt und können insofern nur recht beschränkt überzeugen“) passt die schludrige Rechtschreibung: „Als Aktive aus Gewerkschaften, der Klima- und Umweltbewegung, migrantischen Kämpfe (statt: KämpfeN – Verf.) und der Solidaritätsbewegung mit Geflüchteten wissen wir …“ Die übliche Crew von Unterstützern unterschreibt routiniert, ohne genauer hinzusehen.
Marcus Otto aus der Linkspartei schreibt über sie, „dass überall da, wo Entscheidungsgremien sind, wo Leute sagen können, wo es politisch langgeht, der Anteil von Genossinnen und Genossen, die entweder in Parlamenten oder sonstigen Politjobs ihren Lebensunterhalt verdienen, also vom politischen Betrieb leben, sehr hoch ist. Wir haben uns mal den Vorstand des Berliner Landesverbandes angesehen und festgestellt, dass von 20 Mitgliedern tatsächlich 18 in Parlamenten oder Büros von Abgeordneten oder der Partei sitzen. Es ist hier also so, dass die Leute, die vom politischen Geschäft leben, auch die Entscheidungen darüber treffen, wie es mit der Partei weitergeht. … So herrscht in den Vorständen zweifelsohne eine Wahrnehmung der Lebensrealitäten, die eine andere ist als an der Basis. … Man trifft immer wieder auf Genossen, die inaktiv geworden oder ganz ausgestiegen sind, weil sie sich einflusslos fühlen und mit ihren Anliegen nicht herankommen an die Ebene der Entscheidungen. Die nach dem dritten Antrag, der im Sande verlaufen ist, die Lust verlieren.“
(„Die Ebene der Entscheider koppelt sich ab.“ Gespräch mit Marcus Otto. In: Junge Welt 23.12. 2021, S. 2).
In der Linkspartei ist seit langem eine Tendenz sehr stark geworden, die „die Gewinnung der ‚Köpfe’ der Gewichtung von Posten unterordnet, und desto mehr treten die nur durch Hingabe an die ‚Sache’ gebundenen Mitstreiter zurück hinter den ‚Pfründnern’, wie sie Weber nennt, einer Art von Klienten, die durch die Vorteile und Profite, die er ihnen sichert, dauerhaft mit dem Apparat verbunden sind und die soweit zum Apparat halten, wie er sie hält, indem er ihnen einen Teil der materiellen oder symbolischen Beute zuteilt, die er dank ihrer erringt“ (Pierre Bourdieu). Diese „Pfründner“ lassen sich auch „Politikanten“ nennen. „Wir nennen Politikanten einen Politiker, bei dem der Dienst am Kollektiv ein Vorwand ist, um ökonomische oder psychologische Geschäfte zu machen“ (Fritz Brupbacher).
Angesichts der Ausrichtung der in der Linkspartei Tonangebenden hat es eine kontinuierliche Arbeit für eine selbständige Politik der Lohnabhängigen schwer. Vgl. dazu den desillusionierenden Bericht zu einem Vorzeigeprojekt, der Gewerkschaftskonferenz vom Mai 2023, im Anhang.
Mehr als „Willst Du Frieden für die Welt?“ oder „Gutes Klima für die Reichen?“ stand nicht auf dem jeweiligen Plakat der Linkspartei zur Berliner Wahlwiederholung im Januar 2024. Das grenzt an Realsatire.
Dem Wahlaufruf ist u. a. das Statement von einem „Politik-wissenschaftler“ (sic!) angehängt. Es lautet: „Ich wähle links, weil ohne DIE LINKE der gesellschaftliche Diskurs noch viel weiter nach rechts abdriften würde.“ Dieses negative Urteil bleibt reichlich defensiv. Es ist ungefähr genauso überzeugend wie die Position „Ich bleibe in der katholischen Kirche, weil ohne katholische Kirche keine Caritas und ohne Caritas noch weniger Nächstenliebe in der Welt.“
Immerhin offen ist sie, diese „Werbung“ für die Linkspartei als kleineres Übel. Deren Verwaltern reicht es völlig, wenn nichts so richtig arg und nichts richtig gut wird. Wahlkämpfe finden sie zwar lästig, aber unausweichlich. Denn wenigstens bei Wahlen bekommen die Leute mit, dass es die Linkspartei noch gibt. Fragt sich nur: Wozu?
Anhang:
Bericht von M. Molde zur Bochumer Gewerkschaftskonferenz Mai 2023 (Auszug aus: Neue Internationale, Juni 2023)
Bei den großen Tarifrunden im letzten halben Jahr waren Hunderttausende in Warnstreiks und ähnlichen Aktionen beteiligt. Erkämpfte Erfolge gegen die Inflation und Siege gegen Angriffe auf das Streikrecht wären eine reale „better practice“ der Gewerkschaften gewesen, als die vielen kleinen Beispiele von best practice, die in Bochum verklärt wurden. Eine realistische Bilanz der Tarifrunden kam mit ihren zentralen Fragestellungen in Bochum nicht oder kaum vor.
Beim Eröffnungsplenum kam weder bei Hans-Jürgen Urban vom IGM Vorstand, noch bei Heinz Bierbaum, dem Vorsitzenden der Rosa Luxemburg Stiftung (RLS), das Wort Reallohnverlust oder – entwicklung vor.
Dasselbe Abfeiern der Tarifergebnisse gab es auch aus dem Munde von Thorsten Schulten vom WSI, dem Institut der Hans-Böckler-Stiftung in der AG „Tarifrunden in Zeiten von Inflation, sozialem Protest und konzertierter Aktion“. Auch die anderen Redner:innen bemühten sich darum, die Tarifergebnisse schönzureden, einzig Jana Kamischke, Vertrauensfrau und Betriebsrätin am Hamburger Hafen vertrat eine kritischere Position.
In einem solchen politischen Rahmen erhalten die an sich richtigen Aussagen, dass es in Tarifrunden insbesondere bei der Post und im Öffentlichen Dienst eine bemerkenswerte Beteiligung von neuen und jungen Kolleg:innen gegeben hatte, eine andere Bedeutung.
Nur in wenigen Beiträgen von den Podien schimmerte eine Kritik an der derzeitigen Orientierung der Gewerkschaften und ihrer Führung durch.
So kritisierte Frank Deppe im Themenseminar „Die Waffen nieder! Gewerkschaften in Kriegszeiten gestern und heute“ die sozialpatriotische Politik der Gewerkschaften und ihre faktische Unterstützung von NATO-Erweiterung und Aufrüstung offen und eine Reihe von Redner:innen forderte unter Applaus, dass diese Konferenz eine klare Positionierung gegen die Politik wie überhaupt eine Abschlussresolution verabschieden solle, die sich gegen Sozialpartner:innenschaft und nationalen Schulterschluss mit der Regierung wendet. Doch dabei blieb es auch. Die Organisator:innen der Konferenz hatten nie vorgesehen, dass am Ende der Veranstaltung eine politische Resolution stehen solle, die sie zu einem politischen Handeln verpflichten könnte.
Einigermaßen kritische Töne gegen den Apparat und dessen Legalismus gab es nach Abschluss der Konferenz durch Wolfgang Däubler, der auf die Notwendigkeit des Generalstreiks als politische Waffe gegen die aktuellen Angriffe hinwies.
Bezeichnenderweise hielten diese Beiträge nicht Vertreter:innen der Gewerkschaften, sondern emeritierte Professoren. Sie bildeten letztlich nicht mehr als die kritische Filmmusik zum selbstgefälligen Abfeiern der eigenen „Erneuerung“. So werden Beiträge, die eigentlich konkretisiert und gegen die Bürokratie gerichtet werden müssten, noch zum Beleg für die „Offenheit“ und „Selbstkritik“ der gesamten Veranstaltung.
Kritik an den Apparaten fand insgesamt kaum statt. Wurde in irgendeiner der vielen AGen die Aussage der DGB-Vorsitzenden Fahimi angesprochen, die vor einem halben Jahr gefordert hatte, dass auch Betriebe, die Staatsknete als Energie-Beihilfen erhalten, Boni und Dividenden ausschütten dürfen? Wurde der „Aktionstag“ von IGM, IGBCE und IGBAU skandalisiert, an dem die „bezahlbare Energie“ von der Regierung gefordert wurde – nicht für die Arbeitenden, sondern für die Großunternehmen der Stahl-, Alu und Chemieindustrie? Wo wurde die „Konzertierte Aktion“ angegriffen, als Ausdruck der prinzipiell falschen Sozialpartnerschaft, deren verhängnisvolle Rolle sich gerade in den Tarifkämpfen gezeigt hatte?
Schönreden der Klimapolitik
In der AG 4 „Abseits des Fossilen Pfades“, der tatsächlich noch eine Autobahn, eine Highway to hell ist, bemühte sich Stefan Lehndorf, auch noch jede Alibi-Aktion von Unternehmen, Regierung und IGM schönzureden. So gäbe es „Transformations.Workshops“ in den Betrieben, die durch die Produktumstellung von Arbeitsplatzabbau bedroht seien. Ist Transformation – oder Konversion, wie eine Vertreter der „Initiative Klassenkampf und Klimaschutz“ forderte – der Produktion ein gesellschaftliches Problem oder ein betriebliches? Müssten gerade Gewerkschaften, die sich als „Treiber der Transformation“ sehen (Lehndorf) nicht betriebsübergreifend eine Programmatik und Aktionsplanung haben, anstatt nur betrieblich dem Kapital alternative Produkte vorzuschlagen und es seiner Willkür zu überlassen, ob und wo diese produziert werden?
In dieser AG war immerhin – im Unterschied zu vielen anderen – Diskussion zugelassen, nicht nur Fragen, wie z. B. in der AG 16 (Gegen Betriebsschließungen) oder ergänzende Berichte, wie im Forum zu Tarifrunde Nahverkehr. Wo es mal Kritik gab, wurde diese mit Selbstzensur vorgetragen oder von den Adressat:innen übergangen.
Beispiel Borbet Solingen: Rund 15 Beschäftigte waren zur Konferenz nach Bochum gekommen und zeigten mit Sprechchören ihre Empörung. Auf dem Podium aber saß neben den neuen Belegschaftsvertretern und Aktivisten Alakus und Cankaya der Geschäftsführer der IGM Solingen-Remscheid, Röhrig, der nichts dazu sagte, warum die IG Metall den früheren Betriebsratsvorsitzenden unterstützt hatte, warum sie ein Jahr lang fruchtlose Verhandlungen mitgemacht hatte, ohne einen betrieblichen Widerstand aufzubauen.
Das aktive Verdrängen der „ideologisch-programmatischen“ Fragen ist nichts anderes als ein Codewort dafür, die Kritik an der Gewerkschaftsführung und das Herausarbeiten ihrer Ursachen zu tabuisieren. Die Abgrenzung von angeblichem Sektierer:innentum und Rückwärtsgewandtheit ist nur ein Codewort dafür, keine offene Bilanz der Tarifabschlüsse, von Sozialpartner:innenschaft, Standortpolitik und Klassenkollaboration zu ziehen.
Kämpferische Gewerkschaften wird es letztlich nur im Bruch mit Bürokratie und ihrer Politik zu haben geben. Das bleibt offensichtlich die Aufgabe von Linken Gewerkschafter:innen, die mit der Veranstaltung der Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften einen der wenigen politischen Lichtblicke in Bochum veranstaltet haben.
Quelle: https://www.scharf-links.de/suche/detail/linkspartei-das-kleinere-uebel-und-seine-verwalter?sword_list%5B0%5D=Linkspartei&sword_list%5B1%5D=%E2%80%93&sword_list%5B2%5D=Das&sword_list