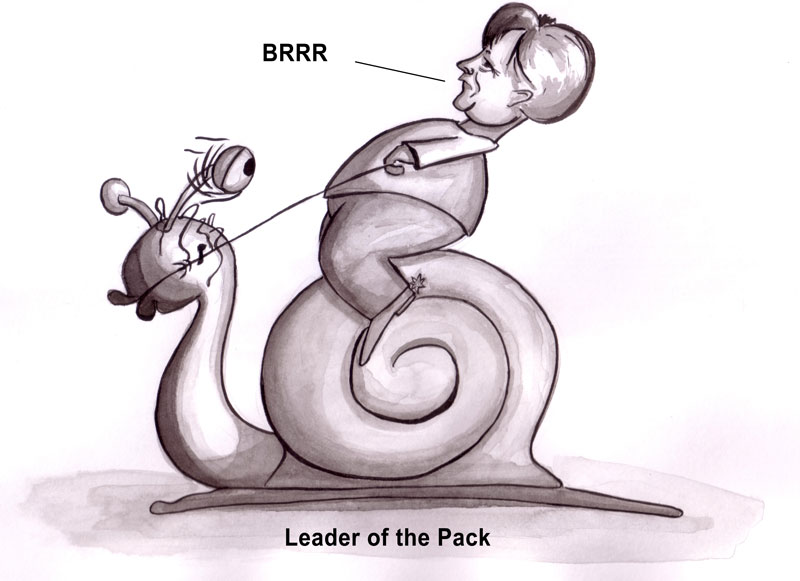Erstellt von Redaktion am 21. Januar 2019
mit dem Mord an Rosa Luxemburg zu tun hat
Eine deutsch-schweizerische Zeitreise

Waldemar Pabst (1880-1970; Offizier, Waffenhändler, Stabschef der österreichischen Miliz Heimwehr, rechts im Bild mit Blumen), Organisator des Mordes an Rosa Luxemburg.
von Paul Kellner / ajour-mag.ch
Vor hundert Jahren ermordeten rechtsextreme Freikorps – mit Zustimmung von SPD-Reichswehrminister Gustav Nokse – die spartakistischen Führungspersonen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.
Waldemar Pabst, der Organisator des Doppelmords, lebte von 1943 bis 1955 in der Schweiz. Von hier aus versorgte er die Wehrmacht mit Kriegsmaterial, betrieb Spionage und wirkte nach 1945 massgeblich am Aufbau einer faschistischen Internationale mit. Dabei wurde Pabst von einem mächtigen Netzwerk aus dem Schweizer Herrschaftsapparat gedeckt und unterstützt. Noch heute leben die Strukturen fort, die den Nazi-Verbrecher protegierten. Höchste Zeit, die Dinge beim Namen zu nennen.
Kürzlich wagte die NZZ ein heisses Eisen anzufassen. Im Artikel «Asyl für einen Nazi-Verbrecher» beleuchtete die wieder deutlich nach rechts gerückte Bourgeoiszeitung eines jener unzähligen Kapitel der Schweizer Geschichte, die nicht so Recht zur angeblich humanitären Tradition dieses Landes passen wollen. Es ging nämlich um das 1948 garantierte politische Asyl für Waldemar Pabst, seines Zeichens Organisator des Mords an Liebknecht und Luxemburg, ausserdem einer der Anführer des konterrevolutionären Kapp-Lütwitz-Putschs, Wehrwirtschaftsführer unter Hitler, Mittelsmann für legale wie illegale Waffengeschäfte sowie eine der umtriebigsten Figuren des internationalen Faschismus des 20. Jahrhunderts.
Heiss ist das Eisen nicht nur, weil die NZZ anfangs der 1930er Jahre die sich formierenden faschistischen Gruppen als willkommene Partner im Kampf gegen links begrüsste und auch Pabst mitunter Respekt zollte. So habe er «sich manche Verdienste um die Heimwehr erworben, deren Organisation zum Teil sein Werk ist». (Zur Erinnerung: Die österreichischen Heimwehren waren jene antisemitischen paramilitärischen Verbände, die in der Zwischenkriegszeit die Arbeiterbewegung zu zerschlagen halfen und im Austrofaschismus polizeiliche Aufgaben übernahmen.) Heiss ist das Eisen insbesondere, weil der Nazi-Verbrecher Pabst in der Schweiz auf unzählige Freunde und mächtige Beschützer zählen konnte und weil die politischen Vereinigungen, die Unternehmen und die Ämter dieser Pabst-Freunde teils noch heute bestehen und bei voller Transparenz eine starke Verunreinigung ihrer noch nie weiss gewesenen Westen riskieren.
Pabsts Schweizer Unterstützer verkehrten in den höchsten Etagen aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Armee und Polizei. Dank unermüdlicher Forschung von Historiker*innen wie Doris Kachulle und Klaus Gietinger sind heute viele dieser Komplizen namentlich bekannt. Doch die NZZ gibt sich diskret und nennt nur gerade einen. Und zwar einen, der wegen seiner ausgesprochenen und hinlänglich bekannten rechtsextremen Gesinnung ohne Verluste als Buhmann vorgeführt werden kann: Eugen Bircher, Chirurg, Oberstdivisionär, Aargauer Bürgerwehrführer und Nationalrat der Bauern- Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB, Vorläuferin der SVP). Es scheint also angebracht, zum hundertsten Todestag von Luxemburg und Liebknecht jene Schweizer Namen und Strukturen zu benennen, die dafür gesorgt haben, dass Waldemar Pabst als Befehlshaber des Doppelmordanschlags ungestraft blieb.
«Einer muss der Bluthund werden» – wie die SPD «die Demokratie verteidigt»
Der aktuelle Niedergang der deutschen Sozialdemokratie lässt sich nicht nur an den historisch abgründigen Wahlresultaten ablesen, sondern auch an den ungeschickten Tweets des Parteiorgans «Vorwärts». Zum Spartakusaufstand 1919 zwitscherte der Vorwärts unlängst ganz ohne Scham: «Die SPD verteidigt die Demokratie – auch mit Hilfe des Militärs». Die Militärhilfe für die damaligen Machthaber der Mehrheitssozialdemokraten (MSPD) leisteten bekanntlich von der Front heimgekehrte Truppen, die sich in rechtsextremen, präfaschistischen Freikorps sammelten.
Selbst wenn der Vorwärts nicht diese Paramilitärs, sondern das halbwegs reguläre Militär meinte, würde es die Sache nicht besser machen. Denn der erste Generalstabsoffizier der preussischen «Garde-Kavallerie-Schützen-Division», also jener Einheit, die 1918/1919 in Berlin die revoltierenden Volksmassen und die Spartakist*innen dahinschlachtete, war niemand Geringeres als Waldemar Pabst. Mit der «Hilfe des Militärs», d.h. nachdem Pabst von Gustav Noske, dem MSPD-Volksbeauftragten für Heer und Marine, die Einwilligung bekam, wurden auch Luxemburg und Liebknecht ermordet. Konkret hatten Pabsts Leute die beiden Kommunist*innen entführt, verhört und dabei schwer misshandelt.
Im Anschluss schlug ein Soldat Luxemburg zwei mal seinen Gewehrkolben ins Gesicht, bevor sie per Kopfschuss gerichtet und später in den Landwehrkanal geworfen wurde. Liebknecht erschossen die Reaktionäre mit drei Kugeln im Tiergarten. Als die «Rote Fahne», die Zeitung der jungen KPD, das Verbrechen aufzuarbeiten begann und Waldemar Pabst bereits als Verdächtigen nannte, wurde der Chefredakteur Leo Jogiches verhaftet und in der Arrestzelle per Kopfschuss polizeilich hingerichtet. Verschiedene SPD-Zeitungen logen darauf, «einer der gefährlichsten Führer der Spartakisten» habe im Gefängnis Soldaten angegriffen und sei aus Notwehr erschossen worden.
Noch bis vor Kurzem leistete sich die älteste Partei Deutschlands eine Historikerkommission, die solche schmutzigen Geschichten etwas eleganter zu verschachteln wusste. Doch diese Kommission ist nun von Andrea Nahles abgeschafft worden und so tritt das Wesen der deutschen Sozialdemokratie wieder ganz unverfälscht zutage. Fast so unverfälscht, wie es Sozialdemokrat Noske schon 1919 zum Ausdruck brachte, als er zu Genosse Reichspräsident Friedrich Ebert, der selber keinen Mordbefehl aussprechen wollte, sagte: «Einer muss der Bluthund werden, ich scheue die Verantwortung nicht!»
Pabsts Ziel: Ein Staatenbund des europäischen Faschismus
Der Mord an Luxemburg und Liebknecht war für den damals 39-jährigen Pabst freilich keine Verteidigung der Demokratie, deren Feind er ja war. So beteiligte sich der Militarist bereits ein Jahr später federführend am Kapp-Lüttwitz-Putsch gegen die junge Weimarer Republik. Für Pabst und seine Getreuen beugte sich die Republik zu sehr den Demobilisierungs- und Abrüstungsbestimmungen des Versailler Vertrags. Da der Umsturz scheiterte, floh Pabst nach Österreich, wo er bis 1930 lebte und politisch wirkte. In Österreich fand Pabst ein ideales Terrain vor, das nur noch wenig Bearbeitung bedurfte, bis es faschistische Früchte trieb. Zur Unterstützung und Faschisierung der Paramilitärs der Heimwehr erhielt der Mussolini-Bewunderer Pabst ab 1922 grosse Geldsummen aus dem faschistischen Italien. Auch verschiedene österreichische und deutsche Waffenindustrielle unterstützten ihn dabei.
Zurück in Deutschland gründete Pabst die «Gesellschaft zum Studium des Faschismus». Diese elitäre Vereinigung stellte ein Bindeglied zwischen konservativen Kreisen aus Militär, Wirtschaftsverbänden und der Presse einerseits und der NSDAP andererseits dar. Bereits drei Jahre nach Pabsts Rückkehr nach Deutschland, wurde die Staatsmacht an Adolf Hitler übertragen. Doch dessen NSDAP empfand Pabst zunächst als wenig attraktiv. Er war der Meinung, die Partei übertreibe mit ihrer grossdeutschen Allmachtsfantasie. Pabsts Ziel war nicht die Dominanz eines einzigen Staates, sondern ein Staatenbund des europäischen Faschismus. So schlug er einen Leitungsposten in der Hitler-Partei aus und schmiedete stattdessen weiterhin an seinen Plänen für eine faschistische Internationale.
Als Waffenhandelsmanager und «Wehrwirtschaftsführer» in der Schweiz
Bald darauf trat Pabst den Posten eines Direktors bei der Rüstungsfirma Rheinmetall-Borsig an und avancierte zum Verkaufschef, der die ausländischen Waffengeschäfte abwickelte. Kurz vor Beginn des deutschen Überfalls auf Polen wurde er – trotz Differenzen zur Systempartei – zum Wehrwirtschaftsführer berufen. Zuvor hatte sich Pabst als sehr effizienter Waffenhandelsmanager bewährt – insbesondere mit Geschäften über die Schweiz. So leitete er ab Januar 1934 die Waffenfabrik Solothurn. Diese hatte Rheinmetall-Borsig 1929 gegründet mit dem Zweck, die Verbote und Einschränkungen des Versailler Vertrages zu umgehen. So diente die Solothurner Waffenfabrik in der Zwischenkriegszeit als Tarnfirma für die Weiterentwicklung deutscher – aber als schweizerisch deklarierter – Waffen und für deren Export.
Die Erzeugnisse aus Solothurn gingen fast ausschliesslich an südamerikanische Diktaturen und an autoritär oder faschistisch regierte Staaten Europas. Auch rechte paramilitärische Verbände wurden im grossen Stil versorgt. So etwa die protofaschistische österreichische Heimwehr, die 1932 nicht weniger als fünfzig Güterwaggons voller Solothurner Waffen erhielt. Verwaltungsrat (und zeitweise VR-Präsident) der todbringenden Fabrik war bis zu seiner Wahl in den Bundesrat im Jahr 1935 der Solothurner FDP-Regierungsrat Hermann Obrecht. Später distanzierte sich Obrecht halbherzig von seinem einstigen Amt und meinte lapidar, dieses sei «bei einem Politiker ein Schönheitsfehler». Im Juni 1938 übernahmen die «Reichswerke Hermann Göring» die Aktienmehrheit der Rheinmetall-Borsig und damit auch der Waffenfabrik Solothurn. Diese war nun also ein Staatsbetrieb Nazideutschlands. Das behinderte aber keinesfalls die Weiterproduktion in der neutralen Schweiz. Die Waffenfabrik Solothurn wurde erst 1948 als Folge des Washingtoner Abkommens, das die alliierten Siegermächte der Schweiz auferlegten, liquidiert.
«Unbedingt im schweizerischen Interesse erforderlich» – Pabsts Tarnfirmen im Schutz des Obwaldner Filzes
Im Jahr 1940 verliess Pabst Rheinmetall-Borsig. Mit der grosszügigen Abfindung von Rheinmetall kaufte sich Pabst zum Hauptgesellschafter der «Auslandshandel GmbH» und gründete im Jahr 1942 in Sarnen im Kanton Obwalden die Im- und Exportfirma «Sfindex». Die Auslandshandel GmbH und die Sfindex fungierten als symbiotische Tarnfirmen, die der Rüstungsindustrie Nazideutschlands dringend benötigte Rohstoffe und Maschinen aus neutralen Staaten besorgten – insbesondere aus der Schweiz. Wenn nötig wurden hierfür auch Rüstungsexportgesetze umgangen. Auch dienten beide Firmen der Wirtschaftsspionage und anderen kriminellen Geschäftspraktiken. Nach dem deutschen Ostfeldzug 1941 sorgte die Sfindex etwa für die Umleitung von für Russland bestimmten Landmaschinen aus der Schweiz.
Die Sfindex gehörte offiziell aber nicht Pabst, sondern dem Letten Gregori Messen-Jaschin, der zusammen mit zwei Schweizer Strohmännern den Verwaltungsrat stellte. Messen-Jaschin stammte ursprünglich aus der Ukraine, floh nach der Russischen Revolution aber nach Westeuropa. Auch er stand spätestens ab 1939 offiziell im Dienst der nationalsozialistischen Wehrwirtschaft. Das Innerschweizer Dorf Sarnen wählte Messen-Jaschin als Standort, weil sein dortiger Rechtsberater Walter Amstalden gleichzeitig katholisch-konservativer Regierungsratspräsident, Ständerat, Präsident der Obwaldner Kantonalbank, Erziehungsratspräsident, Polizeidirektor, ehemaliger Chefredakteur des Lokalblatts sowie ehemaliger Staatsanwalt – also quasi der Alleinherrscher von Obwalden war.
Wegen seiner Sfindex reiste Pabst ab 1941 sehr oft in die Schweiz. Hier gefiel es ihm so gut, dass er sich 1943 dauerhaft niederliess. Von der Schweizer Gesandtschaft in der Reichshauptstadt Berlin erhielt Pabst ein Drei-Monats-Visum, das er ständig verlängern konnte. Dieselbe Gesandtschaft tat dem Geschäftsmann den Gefallen, seine Post aus Deutschland über die eidgenössische diplomatische Kurierpost nach Sarnen zuzustellen. Dies war bedeutend schneller und sicherer als der übliche Postweg. Verantwortlich für diese bevorzugte Behandlung war der nazifreundliche Minister und Schweizer Gesandte in Berlin Dr. Hans Frölicher. Dieser schrieb 1942 an die Fremdenpolizei in Bern, Pabsts Reisen seien «unbedingt im schweizerischen Interesse erforderlich». Unbestritten war Pabsts Tätigkeit im Interesse des schweizerischen Metall- und Maschinenkapitals. Pabst behauptete jedenfalls, er habe Schweizer Industriebetrieben wie der Maschinenbaufirma Rüti, der Hispano-Suiza oder der Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon ein Auftragsvolumen von über 12 Millionen Franken beschert.
Enttarnung Pabsts löst Empörung aus
Lange wusste die Öffentlichkeit nichts von seiner Präsenz und seinem Treiben in der Schweiz. Doch am 22. September 1944 war Schluss mit der Anonymität. Grund war ein Artikel der Zürcher SP-Zeitung Volksrecht, in dem es hiess: «Die Tyrannen und ihre Anhänger, denen es in Europa von Tag zu Tag heisser wird […], schielen nach unserem Lande und suchen hier Aufnahme. Wie in Bern zu hören war, soll sich auch der berüchtigte Putschmajor Pabst in die Schweiz geflüchtet haben, jener Pabst, der 1919 vom Hotel Eden in Berlin aus die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg leitete.» Der Volksrecht-Artikel löste eine riesige Empörung aus, so dass selbst Justizminister Eduard von Steiger (BGB) intervenierte. Er verlangte von der Bundesanwaltschaft ein Verhör Pabsts und, falls eine Mitverantwortung am Doppelmord festgestellt werde, seine sofortige Ausweisung.
Ende April 1944 musste sich Pabst erstmals vor einer schweizerischen Behörde erklären. Doch im Verhör leugnete Pabst jede Verantwortung am Doppelmord vom 15. Januar 1919 und es gelang ihm sogar, den Inspektor der Bundeswanwaltschaft für sich zu gewinnen. Eine Ausweisung war damit vom Tisch. Doch völlig unbekümmert konnte Pabst nicht bleiben. Zumal nun das Armeekommando berichtete, dass seriöse, verschiedene und «keineswegs links stehende» Quellen Pabsts Verantwortung am Doppelmord bestätigten. Zudem brachte der militärische Nachrichtendienst in Erfahrung, dass Pabst im Jahr 1920 als «nächster Mitarbeiter [des] Reichswehrministers Noskes» den Kapp-Lüttwitz-Putsch organisiert habe.
In Österreich habe Pabst, so das Armeekommando bestens informiert, den Waffenschmuggel aus Bayern geleitet und u.a. mit Hilfe italienischer Gelder die Heimwehr «systematisch» in «faschistische Bahnen» geleitet. Pabst, der ein «äusserst gefährliches Element» sei, sei ausserdem ein «engster Vertrauter von Heinrich Himmler […]. Seine Intelligenz, Organisationsgabe und die seltene Geschicklichkeit, seine wahren Absichten zu tarnen, erhöhen seine Gefährlichkeit.» Just in diesem heiklen Moment setzte sich der Oberst und BGB-Nationalrat Eugen Bircher für Pabst ein.
«Kamerad Bircher» mit Pabst am Aarauer Schützenfest
Bircher sprach beim Jutizministerium vor und sagte, er kenne Pabst schon seit 1919, als er noch in Diensten Noskes gestanden habe. Bircher versicherte zudem, der SPD-Mann Noske habe sich ihm gegenüber «sehr lobenswert über diesen Offizier» geäussert. 1924 habe man sich ausserdem am Aarauer Schützenfest getroffen, wo Pabst mit einigen österreichischen Heimwehrlern am Zielschiessen teilgenommen habe.
Tatsächlich kannten sich Bircher und Pabst schon lange. Bircher war 1918 über die Grenzen hinaus bekannt geworden, als er als Reaktion auf den schweizerischen Landesstreik im Amphitheater Vindonissa im Kanton Aargau rund 12’000 Rechte versammelt und die Schweizerische Vaterländische Vereinigung als nationaler Verband aller Bürgerwehren aus der Traufe gehoben hatte. Seither hielt Bircher Kontakt mit führenden Reaktionären verschiedener Länder. Einst wurde gegen den Oberstleutnant sogar wegen des Verdachts ermittelt, er habe Adolf Hitlers Putschversuch von 1923 unterstützt.
Eine Zeitung, die ihn dafür kritisierte, nannte er «Saujudenblatt». 1931 schrieb Pabst an den «Kamerad Bircher» und unterbreitete dem Oberst seine Pläne einer «Weissen Internationale» (WI). Diese Organisation sollte demnächst, so Pabst zum Aargauer, der «ihnen bekannte Herzog Sachsen-Coburg-Gotha übernehmen, womit wir ja eine Persönlichkeit bekommen, die sowohl im Nationalsozialismus wie im Stahlhelm fest verankert ist.» Pabst wollte Bircher als Chef der Schweizer Freikorps dabeihaben und fragte, ob er und seine Verbände «bei der Sache mitmachen». Bircher antwortete postwendend, doch meinte er, dass seine Bürgerwehren «kaum in der Lage sein werden, hier irgendwie aktiv mitzumachen.» Seine politische Stellung erfordere zudem, «mit äusserster Vorsicht an Verbindungen mit dem Auslande heranzutreten.» Gleichwohl plädierte Bircher für die Weiterführung des Nachrichtenaustauschs mit seinem deutschen Freund. Und «persönlich» sei er an der Weissen Internationale durchaus interessiert.
Fremdenpolizeichef Rothmund über Papst: Ein «Gegner des NS» und ein «loyaler und anständiger Mensch»
Wohl wegen der alarmierenden Einschätzung des Militärkommandos folgte im Dezember 1944 trotz allem ein zweites Verhör Pabsts. Wieder leugnete er jede Beteiligung an der Ermordung Luxemburgs und Liebknechts und stellte sich darüber hinaus als Hitlergegner dar. Das erneute Verhör ärgerte Pabst sehr. Es sei ihm «unverständlich, dass jetzt nach 26 Jahren sich in der Schweiz Menschen finden, welche die Sache der Todfeinde der deutschen Demokratie und der deutschen Sozialdemokratie Liebknecht und Rosa Luxemburg zu der Ihren machen.» Dem Untersuchungsbeamten bläute er ein, dass ein Sieg der deutschen Kommunisten 1918/1919 weitreichende Folgen gehabt und diese Entwicklung nicht «bei Basel oder Konstanz Halt gemacht» hätte.
Wieder durfte Pabst bleiben. Hierfür sorgten auch seine mächtigen Schweizer Freunde. Vor allem Eugen Bircher legte sich ins Zeug. Pabst habe der Schweiz verschiedene Wohltaten für Handel und Diplomatie erwiesen. Zudem seien einige der Anti-Hitler-Verschwörer um Stauffenberg seine besten Freunde. In Deutschland gelte er daher als Staatsfeind. Das Kunststück aber, Pabst endgültig zum Widerstandkämpfer umzudeuten, vollbrachte dessen Geschäftsfreund Gregori Messen-Jaschin.
Auch Heinrich Rothmund, Fremdenpolizeichef sowie Chef der Polizeiabteilung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), erklärte Pabst geradeaus zum «Gegner des NS». Natürlich wusste Rothmund, dass Pabst zwar gewisse Differenzen zu Hitler hatte, doch alles andere als ein NS-Gegner war. Der oberste Polizist der Schweiz kannte Pabst schliesslich schon seit Langem, verkehrte mit ihm und anderen Nazigrössen etwa 1942 auch privat in Berlin. Damals besichtige Rothmund in offizieller Funktion das KZ Sachsenhausen und sprach sich bei dieser Gelegenheit gegen die Judenvernichtung aus, obwohl auch die Schweiz «die Gefahr der Verjudung von jeher deutlich erkannt habe». Doch Vernichtung sei falsch, meinte Rothmund, denn man könne den Juden – unter Umständen – auch «als nützliches Glied der Volksgemeinschaft» brauchen. Zudem führe die Vernichtungsmethode nur dazu, «uns letztendlich die Juden auf den Hals [zu] jage[n].»
Deshalb ging Antisemit Rothmund in der Schweiz einen anderen Weg. Als Chef der Fremdenpolizei war er massgeblich für die Grenzpolitik der Schweiz im Zweiten Weltkrieg verantwortlich. Deutsche Juden wurde normalerweise nicht als politische Flüchtlinge aufgenommen. Selbst nach den Novemberpogromen 1938 wurden jüdische Flüchtlinge an der Grenze abgewiesen, wenn sie nicht vorher einen bewilligungspflichtigen Spezialantrag gestellt hatten. Im Januar 1945 schrieb nun Pabst-Freund Rothmund sogar an den Bundesrat und belehrte diesen, dass es nur auf «Nebenwege» führe, wenn man die «Beseitigung» Luxemburgs und Liebknechts in Verbindung mit Pabst zu bringen versuche. Pabst sei nämlich ein «loyaler und anständiger Mensch», einst zwar ein «Heisssporn» könne er heute «als ernstlicher Gegner des Nationalsozialismus und als überzeugter Freund der Schweiz betrachtet werden».
Ein weiterer mächtiger Freund von Pabst war der Herr Dr. Ernst Feisst, Chef des eidgenössischen Kriegs- und Ernährungsamts (EKE). «Als Schweizer in leitender Stellung hat er aus seiner positiven Einstellung zum Dritten Reich seit Jahren nie einen Hehl gemacht», notierte der deutsche Gesandte in Bern über den BGB-Politiker Feisst. Dieser wiederum dankte Pabst einst auch dafür, ihm beste Zuchtpferde für seinen Reitstall besorgt zu haben. Und so erklärte auch Feisst öffentlich, sein Freund Pabst sei ein Kritiker von Hitlers Russlandfeldzug.
Chef der Bundespolizei für Pabsts «Internierung» in Nobelhotels
Immer zahlreicher wurden die Stimmen, die Pabst zum überzeugten Nazigegner und Schweiz-Freund verklärten. So erstaunt es kaum, dass Eugen Bircher nun dem Bundesrat vorschlug, seinen Kameraden als «politischen Flüchtling» aufzunehmen. Doch Justizminister von Steiger war anderer Meinung und verweigerte eine Aufnahme.
Umso günstiger erwies sich deshalb die Erkrankung von Pabsts Gattin Helma. Solange sie akut lungenkrank war, wollte die Schweiz Pabst nicht ausweisen. Im Februar 1945 starb Helma Pabst. Der Wittwer aber durfte bleiben. Doch wie lange noch war ungewiss. Und so schaltete sich ein weiterer Pabst-Freund ein. Werner Balsiger, Chef der Bundespolizei, schlug vor, Pabst nicht wie einen normalen Flüchtling in einem Lager zu internieren, sondern in einem Nobelhotel: «Wir möchten vorschlagen, Pabst unter 1 A einzureihen.» Balsiger wusste Pabst und sein Umfeld sehr zu schätzen. Von Birchers Schweizerischem Vaterländischen Verband (SVV) etwa, der seit seiner Gründung die Linke ausspitzelte und später in direktem Kontakt zur Gestapo stand, erhielt die Bundesanwaltschaft seit den 1920er Jahren denunziatorisches Material – darunter Hinweise und Personenlisten von illegal in der Schweiz lebenden deutschen Linken.
Pabst weilte unterdessen bereits in einem Nobelhotel – wenn auch noch auf eigene Kosten. Im Schlosshotel Locarno verfasste er eine Verteidigungsrede: Er habe es immer gut gemeint mit der Schweiz, hätte sie auch gewarnt, falls Hitler sie einnehmen hätte wollen, etc. Verschiedene offizielle Stellen waren beeindruckt. Doch wieder funkte das Armeekommando dazwischen. In einem Zwischenbericht hielt es nämlich fest, Pabst sei der «Prototyp des militärpolitischen Konspirators. Im Ersten Weltkrieg war er einer der intimsten Mitarbeiter des Chefs der deutschen Militärspionage […]. Unter Hitler lebte Pabst ungeniert in Deutschland. […] Dass Pabst zu dem nationalsozialistischen Regime in Deutschland zum Widerspruch stehen soll, ist nicht glaubhaft. Sicher ist dagegen, dass Pabst, der ein heimtückischer Gegner der Demokratie ist, jedem demokratischen Staat Widerstand bereiten wird, sobald sich ihm dazu Gelegenheit bietet. Pabst versteht es ausgezeichnet, sich in das Vertrauen wichtiger Amtspersonen einzuschmeicheln.»
Oberster Bundespolizist vereitelt Pabsts Auslieferung
Der Weltkrieg war unterdessen beendet und Frankreich verlangte von der Schweiz die Auslieferung verschiedener Kriegsverbrecher. Auf einer entsprechenden Liste war auch Pabst vermerkt, der nun in den Hotels am Lago Maggiore als «interniert» galt. Doch als die Schweizer Behörden den Franzosen einige der Gesuchten übergaben, war Pabst nicht unter dieser Gruppe. Dies durfte der Nazi seinem Freund Werner Balsiger verdanken.
Der oberste Bundespolizist ignorierte schlichtweg das französische Auslieferungsgesuch und hielt es darüber hinaus vor dem Bundesrat geheim. Dennoch erhielt Pabst nun endlich ein Ausreiseersuchen. Justizminister von Steiger bat ihn, bis Mitte Juni 1945 die Schweiz zu verlassen. Diese Zäsur veranlasste Pabsts Schweizer Freunde, eine Aktivität von ungewöhnlichem Ausmass zu entfalten. Unzählige Empfehlungsschreiben und Bettelbriefe wurden verschickt. Im katholisch-konservativen Milieu etwa der Zentralschweiz kam es dabei gut an, dass sich der Umstrittene in Ascona katholisch taufen liess.
Neukatholik Pabst reiste fortan – trotz Internierung – durch die halbe Schweiz und besuchte Freunde. So auch Hans Klein in Meggen am Vierwaldstättersee. Klein war deutsch-chinesischer Doppelbürger und chinesischer Generalkonsul in der Schweiz. Dieser ehemalige Angehörige der Reichswehr und Förderer der «Schwarzen Reichswehr» tätigte ab 1939 von Meggen aus Waffengeschäfte vor allem für Chiang Kai-shek, den nationalistischen Gegenspieler Maos. Ausserdem waltete er in Meggen als Vermögensverwalter des französischen Nazi-Kollaborateurs und einstigen Ministerpräsidenten Pierre Laval. Ebenso verwaltete Klein das in der Schweiz auf Geheimfonds transferierte Kapital der Nazigeheimdienste. «China-Klein», wie man ihn überall nannte, verfügte insgesamt über rund 900 Millionen Schweizer Franken. Später wechselte der einstige Nazifinanzverwalter zu Oerlikon Bührle und in den 1950er Jahren zum Lichtensteiner «Octogon Trust» zur Wiederaufrüstung Deutschlands.
Schmeicheln und betteln bei den Siegermächten
In der Diplomatenvilla von Generalkonsul Klein fühlte sich Pabst geborgen. Zumal bei ihm ein neues Ausreiseersuchen auf den 15. September 1945 eintraf. Pabst teilte den Schweizer Behörden nun mit, er stecke mitten in Verhandlungen mit Briten und Amerikanern. Insbesondere von den Amerikanern erhoffte er sich Milde und sogar eine Aufnahme in der US-Kriegswirtschaft, den Nachrichtendiensten oder Ähnlichem. Zudem wandte sich Pabst an den deutschen Alt-Kanzler Joseph Wirth, der als Vertreter des linken Flügels der Zentrumspartei und als ausgesprochener Gegner des NS seit 1933 in der Schweiz lebte.
Pabst schrieb an Wirth: «Lassen sie mich mitarbeiten, geben Sie mir Gelegenheit, durch Taten unter Beweis zu stellen, dass ich ein guter, echter Demokrat und ein überzeugter Europäer geworden bin.» Mit solch billiger Heuchelei umgarnte Pabst auch Wirth erfolgreich. Mehrmals traf er sich mit dem Zentrumspolitiker. Einmal stellte der Alt-Kanzler dann doch noch die Gretchenfrage betreffend der beiden gemeuchelten Berliner Kommunist*innen. Wieder gab Pabst zur Antwort, er habe nichts damit zu tun, doch sei die Tat ohnehin kein Mord gewesen, sondern überall als Befreiung begrüsst worden – «auch von den Führern der Mehrheitssozialdemokratie».
Unterdessen siedelte Pabst von Kleins Villa ins benachbarte Luzern über, wo er in einem gediegenen Sanatorium residierte. Bald folgte aber der Umzug ins Hotel Löwen in Escholzmatt, seinen neuen Internierungsgasthof. Von dort aus schrieb er Balsiger, dem Chef der Bundespolizei, der einst vorgeschlagen hatte, Pabst «unter 1a einzureihen».
Der Nazi dankte dem Polizisten wörtlich für «das Wohlwollen und das Interesse, welches Sie mir stets entgegenbringen.» Im katholischen Luzerner Dörfchen Escholzmatt hatte Pabst seine Ruhe. Bloss einmal tauchte ein Paparazzo im Hotel auf und fotografierte ihn zusammen mit seiner Sekretärin am Frühstückstisch. Dies erzürnte Pabst so sehr, dass er die Dorfpolizei kommen liess, welche den Fotografen prompt wegwies und seine Kamera samt Film für immer konfiszierte. Dieser Vorfall führte zu einem Aufschrei selbst der konservativen Schweizer Presse. Überall fragte man sich, wer wohl die schützenden «Göttis» seien, auf die Pabst so verlässlich zählen konnte. Pabst aber blieb weiterhin in der Schweiz.
«Herzmuskelschwäche» und ein «Leistenbruch» verhindern Ausweisung
Ende Januar 1946 folgte die dritte Aufforderung, das Land zu verlassen, nun erstmals als «Befehl» formuliert. Doch jetzt setzte sich auch noch der katholische Luzerner Nationalrat Dr. Karl Wick für den Verbrecher ein. Pabst habe der Schweiz als einzigem neutralen Land das Verfahren zur Herstellung von Stahl- statt Messinggranaten verschafft. Das habe man nun zu würdigen, so Wick. Dennoch schien Pabsts Zukunft weiterhin fragil. Doch er wusste sich zu helfen. Pabst wurde krank. Dem 64-Jährigen attestierten befreundete Ärzte eine Herzmuskelschwäche sowie einen Leistenbruch. Prompt wurde Pabsts Ausreisefrist um einen Monat verlängert.
Nun war es wieder Zeit für Bundespolizeichef Balsiger, der erneut für die Gewährung von politischem Asyl plädierte. Schliesslich stehe Pabst auf der Gesuchtenliste der Franzosen. Jutizminister von Steiger wusste bis anhin nicht, dass Pabst auf dieser Liste stand. Balsiger hatte es ihm verschwiegen. Doch anstatt den Bundespolizisten dafür zu massregeln, knickte von Steiger ein. Der Bundesrat schlug sogar vor, Pabst mittels eines plombierten Diplomatenzuges durch die französische in die britische Besatzungszone Deutschlands zu schleusen. Also analog zum Vorgehen, mit dem man einst schon Lenin losgeworden war. Doch das Aussenministerium hatte letztlich doch zu grosse Sicherheitsbedenken. Bei einer solchen Zugfahrt wäre das Entführungsrisiko durch die Franzosen zu hoch gewesen, war es der Meinung.
Pabst, noch immer von der Auslieferung bedroht, spielte nun den todkrank Sterbenden. Er war unterdessen in der gediegenen Luzerner St. Anna-Klinik untergebracht – Seesicht inklusive. Einer seiner vielen Ärzte – auch sein guter Kamerad Dr. Bircher betreute ihn – attestierte ihm nun sogar einen Herzinfarkt. Und das war der definitive Rettungsanker für den faschistischen Verbrecher. Immer und immer wieder wurde seine Ausreise wegen gesundheitlichen Gründen aufgeschoben. «Das Gras wächst», titelte der Basler «Landschäftler» in Hinblick auf die offensichtliche Verzögerungstaktik: Man wisse, so die Zeitung im Juni 1946, dass die juristische Verfolgung der Nazis in der Schweiz «nun langsam in Sande verläuft.
Man hat einige Dutzend kleiner Leute über die Grenze gestellt, auch einige ganz wenige grosse Exemplare, um der Öffentlichkeit zu demonstrieren, dass man etwas tue in der Sache. Aber wirklich gesäubert hat man nicht. Man hat viel mehr sich mit den Nazis in der Schweiz, die jetzt natürlich alle keine Nazis mehr sind und es nie waren, in ein eigentliches Versteckspiel von Rekursen und Verfügungen eingelassen, dank welchem die Säuberung sich über Monate hinzieht und schliesslich allen Beteiligten verleidet, mindestens aber – so hofft man – in der Öffentlichkeit vergessen wird.»
Der «politische Flüchtling» feiert mit seinen Polizistenfreunden
Die «Säuberung» zog sich aber nicht über Monate hinweg, sondern über Jahre und versandete letztlich tatsächlich völlig. Immer neue Atteste erklärten die Spitalpflege Pabsts für unbedingt notwendig. Im Juni 1948 war es schliesslich soweit. Pabst erhielt Asyl als politischer Flüchtling. Dies bedeutete aber, dass er weiterhin «interniert» blieb und ihm jegliche wirtschaftliche und politische Betätigung untersagt war. Doch Pabsts Internierung («unter 1a einreihen») war schon immer eine lockere und wurde stetig aufgelockert.
So begann Pabst sogar wieder ins Ausland zu reisen. Dennoch beschwerte sich der politische Flüchtling bei Bircher über seine Internierung. Pabst meinte nämlich trotzig (aber inhaltlich richtig), andere Nazis könnten in der Schweiz ja auch frei herumlaufen – so etwa der ehemalige SS-Jurist und Ministerialrat Friedrich Kadgien, der bekanntlich «der Haupt-Diamanten- und Devisenschieber Görings» gewesen sei. Aber gewiss möge er «jedem armen Schwein von Deutschen» in der Schweiz einen Aufenthalt gönnen. Offenbar empfand er seine hiesige Existenz als durchaus angenehm. So schrieb Pabst im Januar 1948 an seinen guten Freund Bircher: «Am Donnerstag […] bin ich bei Dr. Balsiger in Bern und eventuell nach dem Ergebnis der Besprechung auch bei Dr. Rothmund. Sind Sie zufällig am gleichen Tage in Bern, dann würde ich gern am Nachmittag mit Ihnen zusammen sein. Mittags bin ich mit Peter Burckhardt und seiner Frau verabredet; wir feiern den ‚Oberstleutnant‘, natürlich wären Sie auch dabei herzlich willkommen.»
Wirtschaftliche und politische Betätigung – trotz Verbot
Pabst ging derweil seelenruhig seinen Waffengeschäften nach. So führte der Internierte – wohl unter dem Schutz von Fremdenpolizeichef Rothmund und Bundespolizeichef Balsiger – in der Schweiz Verhandlungen zum Verkauf der ehemals nazideutschen Waffenfabrik Solothurn. Ende 1948 vermittelte der Major Peter Burckhardt, der bis 1945 Militärattaché der Schweiz in Berlin war, sogar ein Treffen von Pabst und der Abteilung für Heeresmotorisierung der Schweizer Armee. Was genau dort besprochen wurde oder ob sogar Geschäfte getätigt wurden, ist unbekannt. In den 1960er Jahren sollte Burckhardt als Mitglied der Konzernleitung der Oerlikon-Bührle Holding jedenfalls wieder mit Pabst zu tun haben.
Spätestens ab 1948 betätigte sich Pabst in der Schweiz auch wieder offen politisch. So kündete er eine «anti-kommunistische Zeitungsgründung» an sowie einen privaten Nachrichtendienst gegen das kommunistische Jugoslawien. Diesem privaten, internationalen Geheimdienst sollten auch mehrere Schweizer angehören, darunter der katholische Nationalrat Emil Duft aus Zürich, der steinreiche Zürcher Waffenfabrikant Emil Bührle, der Luzerner Jurist und spätere CVP-Nationalrat Hans Stadelmann sowie der katholisch-konservative Departementssekretär des Militär- und Polizeidienstes des Kantons Luzern Dr. Josef Isenschmid.
Für dieses Projekt liess Pabst alte Geheimdienstkontakte wieder aufleben und traf etwa seinen alten deutschen Bekannten Paul Hahn. Der sogenannt «rote Hahn», der in den Kämpfen 1918/1919 ein führendes Mitglied des revolutionären Soldatenrates Württemberg war, verschaffte sich mit der Niederschlagung der Stuttgarter Spartakisten sowie der Münchner Räterepublik grosses Ansehen bei der deutschen Reaktion. Hahn übernahm nach dem unterdrückten Spartakusaufstand das Amt des Oberpolizeidirektors in Stuttgart. Schon 1919 legte er in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Polizeipräsidenten eine Kartei missliebiger und im Krisenfall zu verhaftender Kommunisten an. Nach 1945 baute Hahn im Auftrag der Franzosen die württembergische Staatspolizei auf.
«Die Sache mit Pabst ist grossartig» – Nazi-Geheimtreffen im Zürcher Bahnhofsbuffet
Pabst konnte sich in der Schweiz je länger desto freier entfalten. So hielt er 1948 fest, «die hiesigen Behörden haben dem allgemeinen antikommunistischen Zug in der Welt folgend, mir in der letzten Zeit keine Schwierigkeiten mehr gemacht». Schon ab 1949 wagte er, nach Westdeutschland zu reisen, besuchte alte Freunde wie seinen Putschkameraden und Geheimdienstkollegen Friedrich Wilhelm Heinz. Im Sommer 1950 unternahm Pabst sogar eine Europareise, während der er mögliche Unterstützer einer antikommunistischen Internationale besuchte. Dies geht aus einem von der Kantonspolizei Zürich abgefangenen Brief hervor.
Westlicher Antikommunismus als Freipass für den Nazi-Verbrecher
Ein strafrechtliches Verfahren ist gegen Pabst aber auch nach dem Zürcher Treffen mit Fricke nicht eingeleitet worden. Die Bundesanwaltschaft liess dem kantonalzürcherischen Nachrichtendienst sogar ausrichten, dass man «ziemlich orientiert» sei über Pabsts Treiben. Pabst selbst spreche bei ihr hin und wieder vor. Tatsächlich wusste Bundespolizeichef Balsiger von Pabsts Kontakt zu Fricke. Ob Balsiger auch von den Plänen der neuen faschistischen Internationale wusste oder sogar selbst eine Rolle darin spielen sollte, ist ungewiss. Das Projekt der «Schwarzen Front» scheiterte aber noch in den 1950er Jahren.
Das Interesse an einer neuen faschistischen Internationale war im rheinischen Kapitalismus mit seinem absehbaren Nachkriegsboom schlicht zu gering – sowohl bei den Eliten als auch bei den Massen. Pabst war enttäuscht. Nach den Landtagswahlen in Hessen und Württemberg 1950, als die SPD fast jede zweite Stimme holte, schrieb Pabst ernüchtert an seinen Aargauer Freund Bircher: «Die Deutschen sind und bleiben politisch hoffnungslos». Dabei verbesserten sich die Zeiten für Pabst kontinuierlich. Am 18. Juni 1953 war es schliesslich soweit. Der Nazi erhielt seine Niederlassungsbewilligung für die Schweiz.
In wirtschaftlicher Hinsicht lief es für Pabst in der Schweiz schon 1950 rund. So beteiligte sich Pabst als stiller Gesellschafter mit 40’000 DM an einer Textilfabrik in Konstanz. Den gewünschten Posten als deutscher Handelsattaché in der Schweiz erhielt er zwar nicht, doch mischte er bereits wieder tüchtig im Waffenhandel mit. So meldete sich im Oktober 1950 aus dem von Militärs beherrschten Argentinien sein alter österreichische Freund und Waffenindustrielle Kurt Mandl bei ihm. Der Österreicher suchte Tankabwehr und Antiflugzeugkanonen für den jungen Staat Pakistan und fragte Pabst, ob er aus der Schweiz was deichseln könne. Pabst kontaktierte daraufhin seine Freunde Bircher und Bundespolizeichef Balsiger. Mit Bircher fuhr er sogar ins französische Cap Antibes zu Mandl und besprach dort den Waffendeal.
Bundesrat Stampfli gegen Untersuchung des Falls Pabst
Gegen grosse Widerstände seitens staatlicher Organe der Schweiz leitete die Bundesanwaltschaft 1953 eine Untersuchung gegen Pabst ein. Gemäss der Historikerin Doris Kachulle setzte FDP-Bundesrat Walther Stampfli den SP-Bundesanwalt René Dubois zuvor massiv unter Druck, um eine Untersuchung zu verhindern. Der Solothurner Stampfli pflegte als Einkäufer und später als Direktor der von Roll’schen Eisenwerke in der Zwischenkriegszeit enge Beziehungen zu wichtigen faschistischen Figuren in Deutschland. So wusste er bereits vor den ersten Kriegshandlungen das Datum des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion.
Die Untersuchung kam letztlich aber zustande. Ein Polizeiinspektor kam dabei zu folgendem Ergebnis: «Zusammenfassend halten wir fest, dass sowohl Messen als auch Pabst 1.) im Dienste des Wehrwirtschafts- und Rüstungsamtes des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) standen. 2.) dass die Gesellschaften Auslandshandels GmbH und Sfindex S.A. mit ihren Leitern bzw. Direktoren zu nachrichtendienstlichen Zwecken verwendet wurden. 3.) dass sowohl Messen als auch Pabst Agenten des OKW waren». Da die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten aber als verjährt betrachtet wurden, kam Pabst ohne Strafe davon.
Nachkriegsboom: Schweizer Waffen für Diktatoren und Rassisten
Pabst gehörte nun zu den ersten Unternehmern, die versuchten, in Deutschland erneut eine Rüstungsfabrik zu betreiben. Pabst scheiterte aber vorerst mit der «Wiederbewaffnung» seines geliebten Vaterlands und kam wieder in die Schweiz zurück. Langfristig zog es ihn zwecks Waffengeschäfte dennoch nach Deutschland. Und so liess sich Pabst 1955 in Düsseldorf nieder. Fortan war der gut vernetzte Pabst als Mittelsmann für verschiedene Waffenhändler und Rüstungsbetriebe tätig. Sein Hauptfokus lag dabei auf rechten Diktaturen wie Spanien, Portugal, Taiwan, auf dem rassistischen Südafrika, zudem auf Ägypten als Gegner des neuen Staates Israel und auf Indien als Bollwerk gegen Maos China. Ausserdem beschaffte Pabst Ende der 1950er Jahre für die deutsche Bundeswehr von der Schweiz aus riesige Mengen portugiesischer Patronen. Das Geschäft wickelte Pabst über die Luzerner Kantonalbank ab.
Lange weibelte der mittlerweile gealterte Pabst mit einer speziellen technischen Neuerung. Eine Flüssigtreibstoffrakete, ein Schweizer Fabrikat, versuchte Pabst über mehrere Jahre hinweg an die Bundeswehr zu bringen. Produziert wurde die neue Waffe von der Zürcher Firma Patvag AG, für die Pabst als Berater amtete. Als 83-jähriger Waffenvertreter in Schweizer Diensten machte Pabst sogar noch stundenlange Raketentests durch – zusammen mit Bundeswehr. Ärgerlich war für Pabst, dass die Bundesrepublik die Rakete schliesslich doch nicht wollte. Im Jahr 1964 kam die Absage. Also hörte sich der Waffenschieber um und schielte nach Südafrika. Ungünstig erwies sich indes das in der Schweiz geltende Waffenausfuhrverbot in den Apartheidsstaat. Pabst kannte aber Auswege und schlug vor, als Tarnung Vertriebsfirmen im In- und Ausland zu gründen.
Schliesslich vermittelte Pabst für die Patvag aber einen anderen Deal. Via Deutschland lieferte die Schweizer Firma 25 Tonnen Opalm (ein noch stärkeres Brandmittel als das im Koreakrieg getestete Napalm) nach Kairo, von wo aus Staatspräsident Nasser die Vernichtung Israels verkündete. Eine direkte Lieferung nach Ägypten war nach Schweizer Recht verboten, doch in Deutschland war Opalm nicht als Kampfstoff eingestuft. Ein «judenfreundliches Blatt in Hamburg» (Pabst) bekam jedoch Wind von der Sache und machte den Deal öffentlich. Der Aufschrei war immerhin so gross, dass in der Schweiz u.a. der Tages-Anzeiger eine erneute Verschärfung der eidgenössischen Waffenexportbestimmungen forderte.
Die Patvag stiess übrigens 1963 zur Chemie Holding Ems AG. Sechs Jahre später trat ein junger Mann namens Christoph Blocher in die Firma ein. Er sollte die Ems-Chemie in den 1970er Jahren, definitiv im Jahr 1983, übernehmen. Noch als «Holzverzuckerungs AG» produzierten die Emser Werke aber schon in den frühen 1950er Jahren Opalm – zu militärischen Zwecken freilich. Erst vor 15 Jahren – unter Magdalena Martullo-Blocher – stellte die EMS-Patvag die Produktion von Zündsystemen für die Wehrtechnik gemäss eigener Angabe ein.
Pabst jedenfalls wirkte in den 1960er Jahren weiter in weltweiten Waffengeschäften mit. Politisch verlor der Alte an Einfluss, blieb aber stets Antisemit und Faschist. Ab 1964 gab es auch wieder eine Partei, die er – wenn auch durchaus kritisch – wählte: die NPD.
50 Jahre «das Maul gehalten» – Pabst stirbt
Am 29. Mai 1970 starb der zu neuem Reichtum gelangte Waffenschieber endlich. Beerdigt wurde er gemäss seinem letzten Willen in Muri bei Bern, wo bereits seine Ehefrau lag. Später fand man in Pabsts Nachlass die Abschrift eines Briefes aus dem Jahr 1969. Darin reflektierte Pabst die Ermordung von Luxemburg und Liebknecht, auf die er zeitlebens stolz war: «Dass ich die Aktion ohne Zustimmung Noskes gar nicht durchführen konnte – mit Ebert im Hintergrund – und auch meine Offiziere schützen musste, ist klar. Aber nur ganz wenige Menschen haben begriffen, warum ich nie vernommen oder unter Anklage gestellt worden bin. Ich habe als Kavalier das Verhalten der damaligen SPD damit quittiert, dass ich 50 Jahre lang das Maul gehalten habe über unsere Zusammenarbeit.»
Die longue durée der Reaktion
Was aber hat der SVP-Übervater Christoph Blocher mit dem Mord an Rosa Luxemburg zu tun? Luxemburg wurde 1919 in Berlin erschlagen und erschossen, Blocher 1940 in Schaffhausen geboren. Einige Strukturen und Netzwerke aber, die den Tod der Spartakistin zu verantworten hatten, bestehen in gewandelter Form bis heute. In ihrem Umfeld vollzog sich auch der politische und wirtschaftliche Aufstieg von Leuten wie Blocher. Waldemar Pabst wickelte für die Patvag, die heute zur Ems-Chemie gehört, Deals mit dem südafrikanischen Apartheidstaat ab. Blocher, ab 1973 Direktionsvorsitzender der Ems-Chemie AG, gründete 1982 die antikommunistische Organisation «Arbeitsgruppe südliches Afrika» (ASA).
Mithilfe dieses Vehikels unterstützte Blocher das rassistische Regime, das er als Bollwerk gegen den Kommunismus in Afrika betrachtete und dem er – wie einst Pabst – waffenfähiges Material lieferte. Ein weiteres prominentes ASA-Vorstandsmitglied war übrigens der damalige SVP-Nationalrat Ulrich Schlüer, der in seiner Jugend Sekretär des Faschisten und ehemaligen Fröntlers James Schwarzenbach war.
Die Aargauische Vaterländische Vereinigung (AVV), die Pabst-Freund Eugen Bircher nach dem Landesstreik als Bürgerwehr gegründet hatte, besteht bis zum heutigen Tag – wenn auch als offensichtlich greiser Altherrenverein. Präsidiert wird dieser vom extrem rechten SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Als die AVV im vergangenen November ihr 100-Jahr-Jubiläum feierte, war der historische Rückblick dem Ex-Nationalrat Christoph Mörgeli vorbehalten. Blocher wiederum lobte im November 2018 an seiner Ustermer Generalstreik-Veranstaltung die «unerschütterliche Haltung von Bürgertum, Bauernschaft [und] Armee» während des Landesstreiks 1918. Der SVP-Milliardär verklärt den Landesstreik bis heute zum versuchten «revolutionären, bewaffneten Umsturz» und verherrlicht damit jene Kreise, die damals in der Schweiz kurzzeitig eine faktische Militärdiktatur errichteten und paramilitärische Strukturen schufen.
Blochers Lob schliesst damit insbesondere solche Personen ein, die vor hundert Jahren die Niederschlagung des Landesstreiks wesentlich prägten. Dazu gehört etwa der damalige, offen deutschfreundliche General Ulrich Wille, der in Zürich – wie er selber sagte – «die Gegenrevolution organisieren» liess. (Willes nazifreundliche Tochter Renée Schwarzenbach-Wille war übrigens die Tante vom oben erwähnten Rassisten James Schwarzenbach.) Auch gemeint ist der damalige Zürcher Platzkommandant Emil Sonderegger, der gegebenenfalls Handgranaten in Arbeiterwohnungen werfen lassen wollte und später Waffenhändler und ein prominenter Faschist der Frontenbewegung wurde. Auch der Generalssohn Ulrich Wille II., während des Generalstreiks als übereifriger Offizier tätig, schliesst Blocher aus seinem Lob nicht aus.
Ein Detail wohl, dass Wille junior 1923 einen gewissen Adolf Hitler in seiner «Villa Schönberg» in Zürich-Enge empfing. Ein Detail auch, dass Hitler dort vor rund vierzig Industriellen vorsprechen und rund 30’000 Franken sammeln konnte, womit er zwei Monate später seinen Putschversuch in München finanzieren sollte. Ulrich Wille junior empfing in den Jahren 1922 und 1923 darüber hinaus regelmässig auch den jugendlichen Hitler-Anhänger Rudolf Hess, damals Student in Zürich. Auch Hitlers Spendensammler und Privatsekretär Emil Gannser besuchte den deutschtümelnden Generalssohn. Gannser wiederum traf sich nach Hitlers gescheitertem Münchner Putsch in der Schweiz mit Pabst-Freund Eugen Bircher zu einer Besprechung. Kaum denkbar, dass Blochers Lob nicht auch dem Offizier und Bürgerwehrführer Bircher gelten sollte.
Die historischen Kontinuitäten betreffen allerdings keinesfalls bloss die Vergangenheit. Auch heute versuchen die bürgerlichen Parteien – allen voran die SVP – die ohnehin laschen Bestimmungen zum Rüstungsexport noch weiter zu lockern, damit künftig auch in Bürgerkriegsgebiete geliefert werden kann. Auch heute fliessen bekanntlich Gelder und andere Unterstützungsleistungen aus dem Umkreis der SVP an die neuen Nazis der AfD. Und auch heute wagen rechte Schweizer Politiker, etwa SVP-Nationalrat Roger Köppel, wieder den Schulterschluss mit Rassisten und Faschisten, etwa mit Steve Bannon, oder demonstrieren Seite an Seite mit deutschen Neonazis und NSU-Unterstützern durch Chemnitz.
Immerhin ist heute auch wieder vorstellbar, dass solche deutsch-schweizerischen Traditionen einmal irreversibel zerstört werden. «Eure ‚Ordnung‘ ist auf Sand gebaut», schrieb Rosa Luxemburg am Tag vor ihrer Ermordung und liess die Revolution selbst «mit Posaunenklang verkünden»: Ich war, ich bin, ich werde sein!
Soweit nicht anders angegeben und keine Quellenangabe (Name einer Organisation oder Internet-Adresse) vorhanden ist, gilt für die Texte auf dieser Webseite eine Creative Commons Lizenz (CC).
—————————————————————————
Grafikquelle : Waldemar Pabst (1880-1970; Offizier, Waffenhändler, Stabschef der österreichischen Miliz Heimwehr, rechts im Bild mit Blumen), Organisator des Mordes an Rosa Luxemburg. / Bundesarchiv, Bild 183-2005-0413-501 (CC BY-SA 3.0